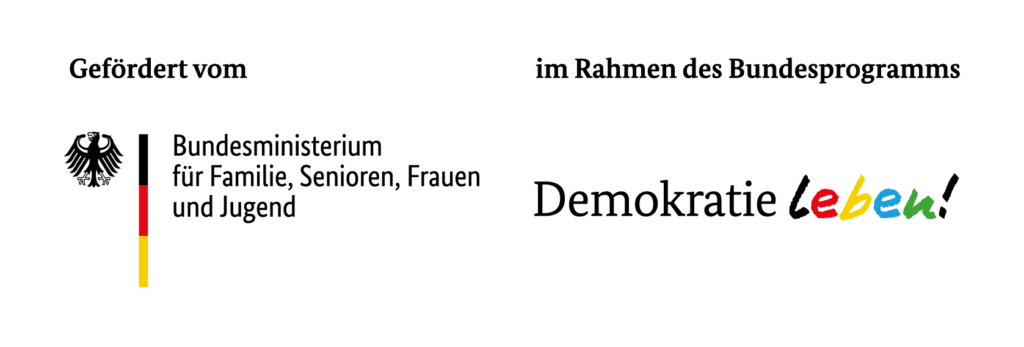Sie hat es wieder getan. Dem Kreistag von Teltow-Fläming liegt erneut ein Antrag vor, der Kreisverwaltung das Gendern zu untersagen. Die Verbotsfraktion stützt sich dabei auf Zahlen, die das Meinungsforschungsinstitut Civey für den Nachrichtendienst t-online in einer Umfrage ermittelt hat: 80 Prozent der Erwachsenen lehnen das Gendern ab. Unerforscht blieb, räumt t-online ein, ob es dabei vornehmlich um die ungeliebten Sonderzeichen ging oder auch um eher anspruchsvolle Formulierungen zur Geschlechtergerechtigkeit.
Sie hat es wieder getan. Dem Kreistag von Teltow-Fläming liegt erneut ein Antrag vor, der Kreisverwaltung das Gendern zu untersagen. Die Verbotsfraktion stützt sich dabei auf Zahlen, die das Meinungsforschungsinstitut Civey für den Nachrichtendienst t-online in einer Umfrage ermittelt hat: 80 Prozent der Erwachsenen lehnen das Gendern ab. Unerforscht blieb, räumt t-online ein, ob es dabei vornehmlich um die ungeliebten Sonderzeichen ging oder auch um eher anspruchsvolle Formulierungen zur Geschlechtergerechtigkeit.
Sei’s drum: Die Fraktion wartet in ihrer Antragsbegründung mit beeindruckendem Wissen um gesellschaftliche Hintergründe des Genderns jeglicher Art auf. Ein politikwissenschaftlich vorgebildeter Abgeordneter erkannte nach Presseberichten auf ein üppig Maß an Eigeninteresse der bundesdeutschen Elite, die allein das Genderprojekt vorantreibe. Und so ist klar, dass die Elite der drittstärksten Wirtschaftsmacht durchregiert bis in die Formulierungskünste so mancher Sachbearbeiterin in der Kreisverwaltung des brandenburgischen Teltow-Fläming. Zu so was haben die Zeit.
Dabei scheint die Elite recht planlos auf ihr Ziel hinzuwirken. Noch steht es allen frei, sich zum Gendern zu verhalten, in den Bundesländern wird mal so, mal so verfahren. Wer dem Glottisschlag verfallen ist, praktiziert ihn ungestraft, andere lässt das flatterhaft Aufgeregte um das Thema völlig unberührt. Wo sonst lässt sich das eine durchsetzungsstarke Elite bieten?
Andere Umfragen, andere Ergebnisse. Das Kölner rheingold Institut hat in einer Studie festgestellt, dass die Mehrheit der jungen Leute zwischen 14 und 35 Jahren inzwischen ziemlich genervt ist von der Debatte ums Gendern. „Gleichzeitig sehen darin vor allem junge Frauen ein wichtiges Signal auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung und einem moderneren Geschlechterverständnis,“ heißt es da, „44 % aller Befragten erachten die Diskussion als wichtig und gerechtfertigt.“
Vor allem bei Unternehmen scheint die Achtsamkeit gewachsen, besonders bei der Personalsuche, denn: „Fehlendes Gendern lässt den Arbeitgeber eher altmodisch und für jüngere Zielgruppen weniger attraktiv erscheinen.“
„Es gibt jedoch Diskursteilnehmer*innen, die kaum Interesse an einer solchen friedlichen, konstruktiven Art der Auseinandersetzung haben. Dass dies gerade diejenigen sind, die andererseits vor einer ‚Spaltung der Gesellschaft‘ warnen, müsste offensichtlich sein.
Übernimmt man dieses Narrativ, obwohl man sich dem inhaltlichen Ziel einer geschlechtergerechten Sprache nicht entgegenstellt, geht man meines Erachtens populistischen Kräften ‚auf den Leim‘.“ (Carolin Müller-Spitzer, Der Kampf ums Gendern)
Auch das Institut für Generationenforschung in Augsburg hat in mehreren Studien einen Blick aufs Gendern geworfen. Alter und Geschlecht der Befragten waren in der Regel ausschlaggebend für die Haltung zum Thema. Festgestellt wurde aber auch: Zwischen Befürworterinnen und Ablehnern geschlechtergerechter Sprache scheint es immer weniger Gelassenheit zu geben. Institutsleiter Rüdiger Maas schreibt zu den Problemen der wissenschaftlichen Ermittlungen bei den Umfragen: „Wir haben in Deutschland bei gesamtgesellschaftlichen Diskursen keine Ambiguitätstoleranz mehr, fast nur noch Extreme.“
Sprachwissenschaftler Robert Kaehlbrandt, Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, pflichtet dem bei: „Ich wünsche mir aber, dass wir aus dieser Sackgasse, dieser Polarisierung und Aufgeregtheit herauskommen und dass wir bei unserem Streit eine vernünftige Gesprächskultur wahren.“
Sprache ändert sich von unten, sagt Lara Schwenner, die sich umfassend mit dem Thema auseinandergesetzt hat unter dem Titel „Was Gendern bringt und was nicht.“ Ihr Fazit wird die Verbotsfraktion im Kreistag in ihrem Kreuzzug gegen die Freiheit zur Geschlechtergerechtigkeit nicht erfreuen: „Was sich im Sprachgebrauch durchsetzen wird, entscheiden am Ende allerdings wir selbst – so ist es immer schon gewesen.“
Foto: Marek Studzinski/Unsplash